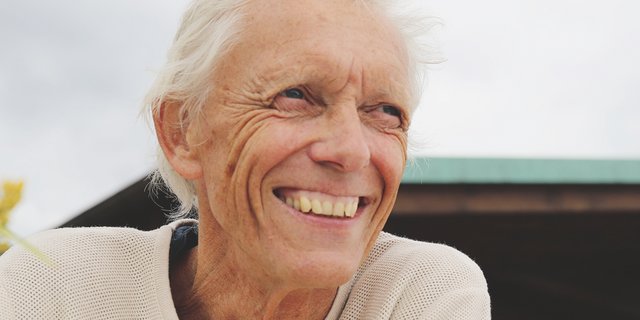Von der Ästhetik der Stadtlandschaft
Schöne Natur, ansehnliche Architektur, störende Autos
Natur ist fast immer schön, jedenfalls unzerstörte, "naturbelassene". Aber auch kultivierte Natur, Landschaften, Parks, Gärten können wir in unserem Zusammenhang noch als Natur gelten lassen, im Kontrast zur Nicht-Natur der Gebäude, Straßen, Verkehrsmittel und Technik überhaupt – die nicht hässlich sein müssen. Ebenso ist Grün fast immer schön – in der Stadt, im Land und am…