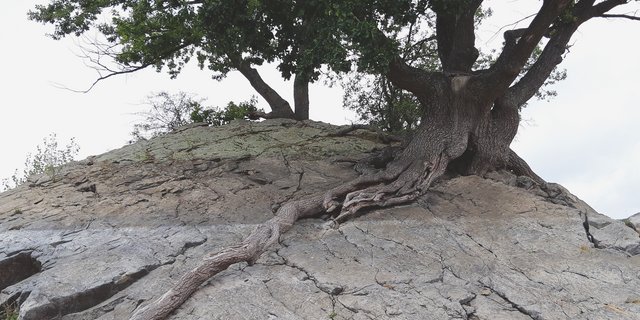Biotopentwicklung am Max-Planck-Institut
Das BioDiversum in Göttingen
von: Dipl.-Ing. Wolfgang Wette, Dipl. Ing. Ulrich KünekeDer bekannte Ornithologe und Max-Planck-Forscher Prof. Peter Berthold zeigte in einem Vortrag in der Wissenschaftsreihe beim Göttinger Literaturherbst 2018 drastisch den Rückgang von Biotopen und das damit verbundene rasante Artensterben von Tieren und Pflanzen auf.
Wissenschaftler*Innen der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) forschen zum Teil seit Jahrzehnten auf dem Gebiet der…