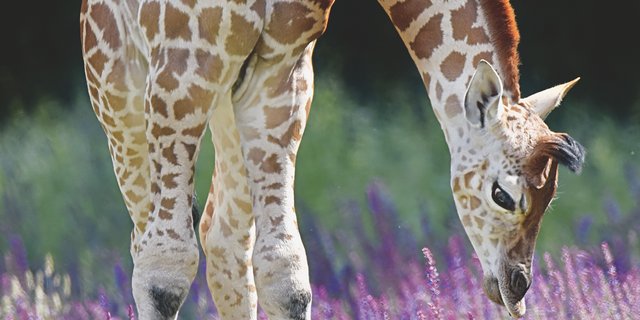Vom reinen Recycling hin zur Gestaltung
Zirkuläres Bauen in der Landschaftsarchitektur
von: Dr.-Ing. Katrin KorthEines der neuen Schlagworte beim Planen und Bauen ist zirkuläres Bauen. Im Hochbau wird damit bereits seit einiger Zeit experimentiert. Der Ansatz ist konstruktiv-gestalterisch intendiert: Gebrauchte Bauteile werden wiederverwendet und sollen innerhalb neu entstehender Bauwerke auch bauwerksgestaltend wirken.
Dieser Ansatz geht über bisherige, eher lineare Bauprozesse hinaus, in…