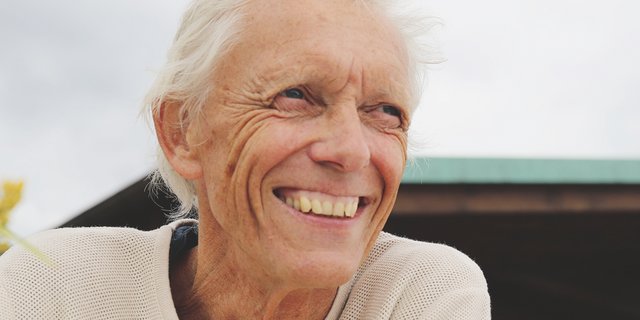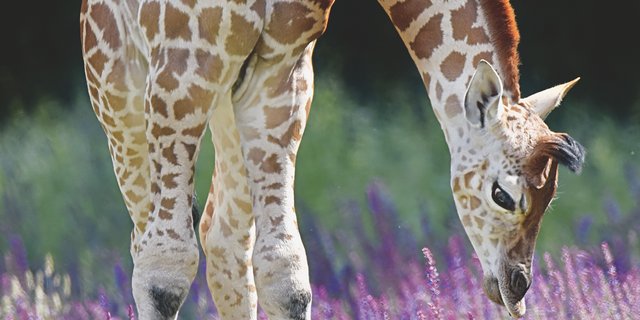Kooperative Wettbewerbsverfahren als Chance für Transformation
Gemeinsam statt gegeneinander
von: Sandra Feder, Prof. Dr Simone Linke, M. Sc. Doris Bechtel, Florence Baur, Sebastian Händel, Kira Rehfeldt, Eva-Maria Moseler, Dr. Teresa Zölch, Prof. Dr. Werner Lang, Prof. Dr. Stephan PauleitLandschaftsplanerische-städtebauliche Wettbewerbe sind ein etabliertes Instrument, um kreative Ideen und gute Lösungen für unsere Städte zu finden. Jedoch sind nicht in jedem Fall konkurrierende Wettbewerbe die einzige Lösung. Um gemeinsame Herausforderungen anzugehen und eine bessere Zukunft für alle zu gestalten, können auch kooperative Verfahren Vorteile versprechen.
Im…