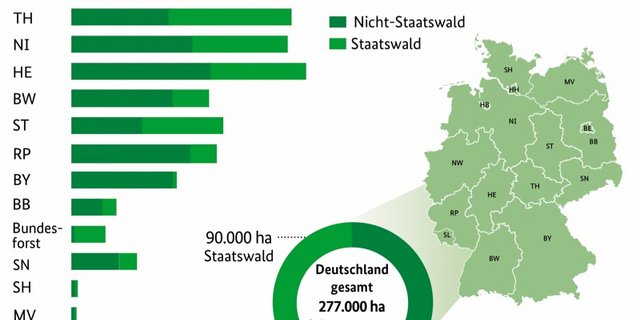Von der Eiszeit bis zur Stadtplanung: Birken im Wandel
Die Birken – Überblick, Verwendung und Risiken in der Stadt
Während der ökologischen Katastrophe der nordeuropäischen Elster-, Saale- und Weichseleiszeiten (vor rund 2 Millionen bis etwa vor 20.000 Jahren) starben viele Pflanzenarten in Mitteleuropa aus. Nachdem vor ca. 20.000 Jahren die letzte Eiszeit (Weichsel-Glazial) ihren Höhepunkt mit dem Brandenburger Stadium erreicht hatte, begann die Klimaerwärmung der bis heute andauernden…