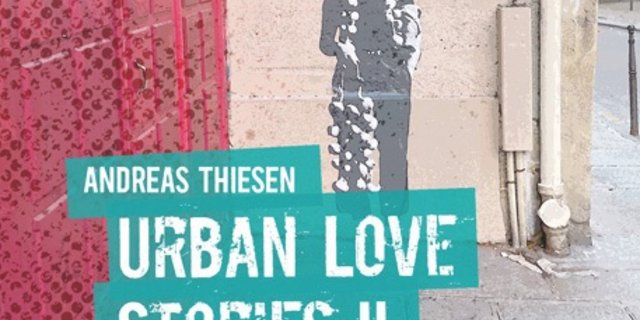Herbst in der Musik
„Bunt sind schon die Wälder . . . “
von: Prof. Dr. Hanns-Werner HeisterHerbst ist ein Phänomen der Natur und zugleich ein wichtiges Thema der Musik und anderer Künste. Vier Jahreszeiten, vier Elemente, vier Temperamente – vieles ist viergeteilt. Die Jahreszeiten erscheinen im doppelten Sinn natürlich. Sie sind es und sind es nicht.
Vorrangig erscheinen sie als Temperaturveränderungen, die durch den gleichbleibenden Neigungswinkel der Erdachse…